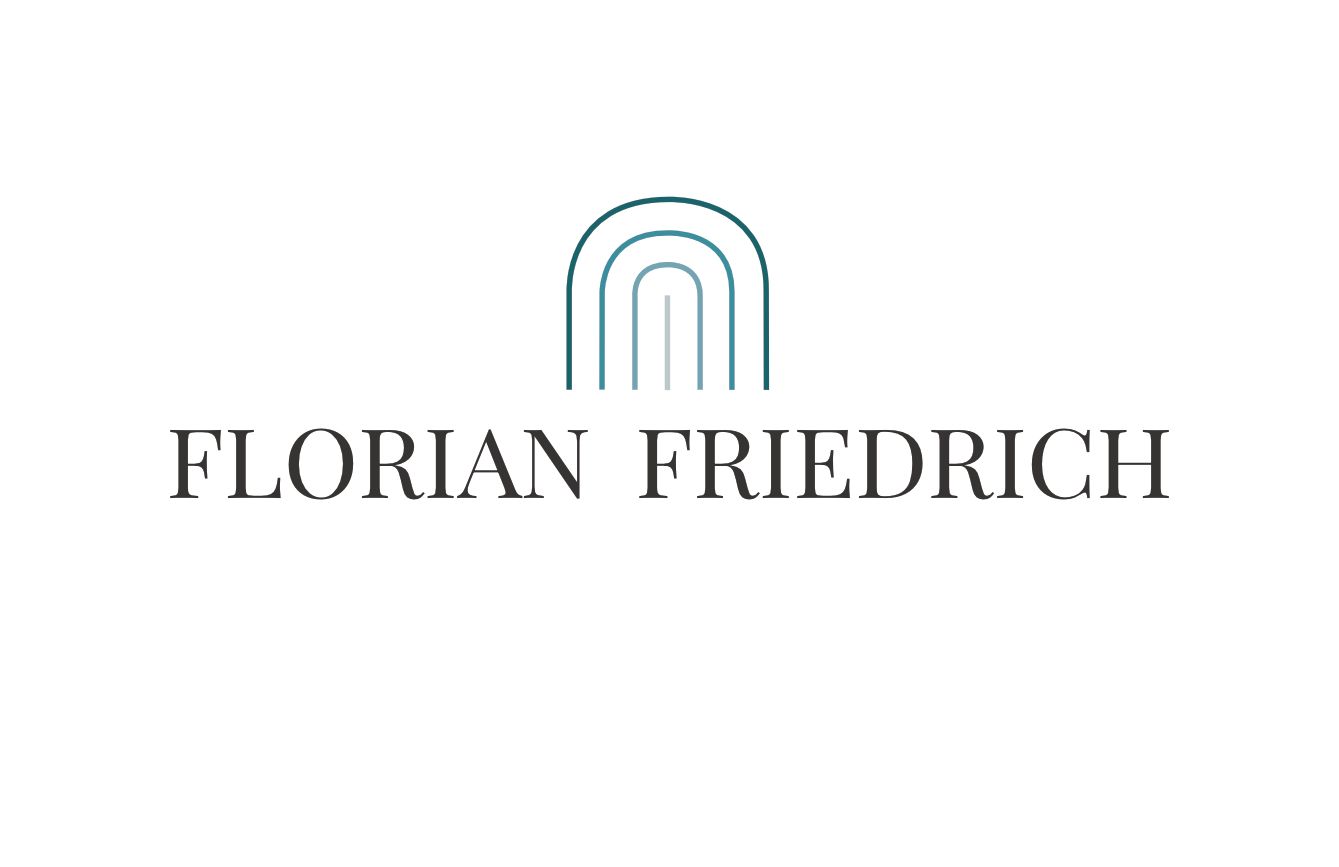Konflikte und Probleme in der Partnerschaft überwinden
Verantwortung für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse
In einer guten, erwachsenen Partnerschaft sehen sich beide Partner*innen als eine 50:50 GmbH. D.h. jede*r Partner*in ist für den Umgang und erwachsenen Ausdruck der eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Emotionen selbst verantwortlich, und kein*e Partner*in ist für den/die andere*n verantwortlich. Allerdings sind beide Partner*innen verantwortlich für die Gestaltung der Beziehung und die Paardynamik. Beide übernehmen Verantwortung für die Partnerschaft und beide haben die Pflicht, ihr Bestes für die Beziehung zu tun und zu geben.
Lesen Sie in diesem Beitrag, wie Sie gut und konstruktiv Probleme und Konflikte innerhalb Ihrer Partnerschaft überwinden können.
Ich biete Paartherapie bei Beziehungsproblemen an.

Video: Gunther Schmidt "Wenn die Beziehung wirklich gut wäre"
Vater- und Mutter-Übertragungen in Partnerschaften
Dabei wissen beide, dass der/die Partner*in nicht die eigenen biografischen Wunden und Traumen kompensieren oder gar wiedergutmachen kann.
Gerade hier kommt es in vielen Partnerschaften und Beziehungen zu Problemen, denn unbewusst und in den Tiefenschichten unserer Psyche verwechseln viele Menschen ihre Partner*innen mit Mutter oder Vater. Diesen Vorgang nennt man in der Psychotherapie „Übertragung“.
Wir alle übertragen, haben aber als Menschen die Fähigkeit, gut mit diesen Übertragungen umzugehen.
Wie kann ich Übertragungen erkennen?
- Wenn ich mich mit meinem/meiner Partner*in immer wieder im Kreis drehe und sich ähnliche Konflikte ständig wiederholen.
- Wenn ich davon ausgehe, dass der andere Mensch immer Schuld hat.
- Wenn ich davon ausgehe, dass ich selbst immer Schuld habe.
- Wenn ich in und nach Konflikten meine eigenen Anteile nicht erkenne oder diese abstreite.
- Wenn kleine Nichtbeachtungen massive Emotionen bei mir auslösen.
- Wenn ich innerhalb der Partnerschaft auf einmal von Emotionen überflutet werde.
- Wenn ich mich dabei ertappe, dem/der anderen Vorwürfe zu machen oder nach Ursachen im Außen zu suchen, anstatt, dass ich von mir spreche.
- Wenn ich manipuliere.
- Wenn ich rasch Schuldgefühle habe, die zu hoch und der tatsächlichen Situation nicht angemessen sind (differenziere tatsächliche Schuld vs. Schuldgefühle).
- Wenn ich starke Verlustängste habe.
- Wenn ich mich schnell klein und hilflos fühle.
- Wenn ich Pseudogefühle zeige: etwa wütend bin, aber lächle oder weine; oder wenn ich traurig bin und mich stattdessen wütend gebe.
- Wenn ich immer wieder in toxischen Partnerschaften lande und die Frühwarnzeichen nicht erkenne oder nicht ernst nehme.
- Wenn ich zu Beginn einer Beziehung extrem verliebt bin und die/den andere*n stark idealisiere, dann aber beim Nachlassen der Verliebtheit die Beziehung rasch beende.
- u.v.m.
Podcast von Verena König: "Wenn Gefühle erlöschen - Beziehungsdynamiken bei frühem Trauma"
Viele Menschen trennen sich nach der Phase der Verliebtheit. Erfahren Sie in diesem Podcast von Verena König, warum frühes Bindungstrauma zu emotionalem Rückzug und Beziehungsproblemen führen kann.
Der/die Partner*in als Retter*in oder Heiler*in, der/die alles wiedergutmachen soll
Defizite, wie ein Liebesmangel durch die Eltern oder andere prägende Bezugspersonen, werden immer auch in die Partnerschaft hineingetragen. Der/die Partner*in soll dann wiedergutmachen und heilen, was etwa die Eltern verwundet haben. Dies ist allerdings unmöglich, und kein*e Partner*in vermag diese frühen Mängel an bedingungsloser Liebe, Zuneigung und Nähe auszugleichen.
Eine realistische Liebe ist weniger strahlend und aufregend als die idealisierte Sehnsuchtsliebe, die langfristig nur zu Frustrationen und Enttäuschungen führen kann. Die Realliebe bietet allerdings viel größere Chancen auf Befriedigung, Zufriedenheit und Weiterentwicklung.
Konstruktive Konflikte
Ich selbst habe dabei keine oder kaum Macht, den/die Partner*in glücklich oder unglücklich zu machen und umgekehrt. Selbst bei bösartigen Aussagen und Abwertungen habe ich als erwachsener Mensch immer die Fähigkeit, zu prüfen, ob diese Abwertung auf mich zutrifft oder nicht, und kann sie dann zurückweisen oder auch berechtigte Kritik herausfiltern. Ich kann dann z.B. feststellen, dass mein*e Partner*in gerade auf mich überträgt und ich gar nicht wirklich gemeint bin, sondern mein*e Partner*in gerade in seiner/ihrer eigenen Psychodynamik gefangen ist.
Es geht dann weniger darum, was ich für den/die Partner*in tun kann, sondern was ich innerhalb der Partnerschaft dazu beitragen kann, dass wir gut kommunizieren, uns verstehen, uns so sehen, wie wir im tiefsten Innersten wirklich sind, und dass wir einander vertrauen können.
Natürlich kann es passieren, dass nur eine*r der Partner*innen über diese Fähigkeiten verfügt. Das ist aber immer noch besser, als wenn beide Partner*innen ständig aufeinander losgehen und sich das Leben zur Hölle machen, sich bekriegen oder psychisch fertig machen.
Negativbeispiel für destruktive Übertragungen aus dem Paaralltag:
A: „Du rufst mich seltener an, du liebst mich nicht mehr so sehr und vernachlässigst mich.“
B: „Nein, das stimmt ja gar nicht.“
A: „Doch, sonst wüsstest du, wie schlecht es mir geht.“
B: „Ich kann doch nicht deine Gedanken lesen.“
A: „Weil du dich nicht für mich interessierst.“
B: „Das nervt mich.“
A: „Siehst du! Wenn du mich mehr lieben würdest, dann würdest du dich für mich interessieren.“
Es folgt eine stundenlange oberflächliche Diskussion mit Schuldvorwürfen, die beide erschöpfen.
Positivbeispiel 1 für gelingende Kommunikation:
A: „Du rufst mich seltener an, du liebst mich nicht mehr so sehr und vernachlässigst mich.“
B: „Es war mir gar nicht bewusst, dass dich das so beschäftigt.“
A: „Doch, aber offensichtlich interessierst du dich ja nicht mehr für mich.“
B: „Dann frage ich mal nach: Wie geht es dir denn damit?“
A: „Ich habe Angst.“
B: „Das hab ich nicht gemerkt. Bitte sage mir von nun an klipp und klar, wenn du mit mir telefonieren willst.“
A: „Das solltest du aber spüren.“
B: „Manchmal bin ich im Alltag nach der Arbeit sehr müde und bin dann nicht mehr so empathisch. Ich brauch dann von dir eine klare Ansage.“
A: „Dann ist es ja nichts wert.“
B: „Für mich schon, weil ich gerne mit dir telefoniere. Umgekehrt gilt aber auch: Wenn ich mal nicht telefonieren möchte, dann werde ich dir sagen, dass ich heute nicht will.“
Positivbeispiel 2:
A: „Du rufst mich seltener an, das macht mir Angst, weil ich es nicht verstehe. Ich habe Angst, dass ich dir weniger bedeute oder dass du nicht mehr an mir interessiert bist.“
B: „Nein, das stimmt ja gar nicht. Du bedeutest mir so viel. Ich war aber jetzt beruflich mit meinen vielen Meetings so eingespannt, dass ich keine Kraft mehr hatte, am Abend zu telefonieren.“
A: „Gut zu wissen, das erleichtert mich.“
B: „Sag es mir, wenn dir etwas Angst macht oder du mit mir telefonieren möchtest. Ich sage dir dafür auch, wann ich mit dir telefonieren möchte und wann nicht. So kommt keiner von uns beiden in die Situation, Rätsel raten zu müssen, wann der andere will und wann nicht.“
Meine Weiterempfehlungen der paartherapeutischen Fortbildungen von Gunther Schmidt
Gunther Schmidt: "Liebe in polygam-monogamen Paarbeziehungen"